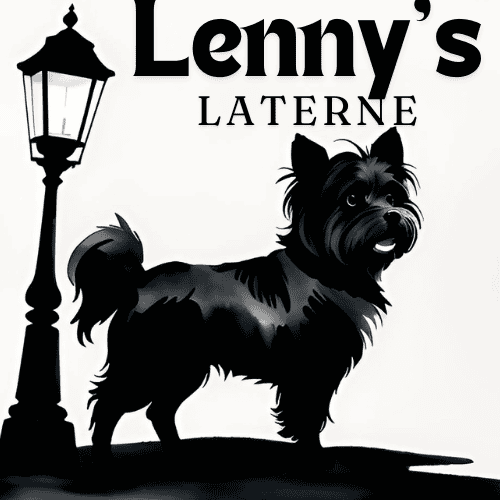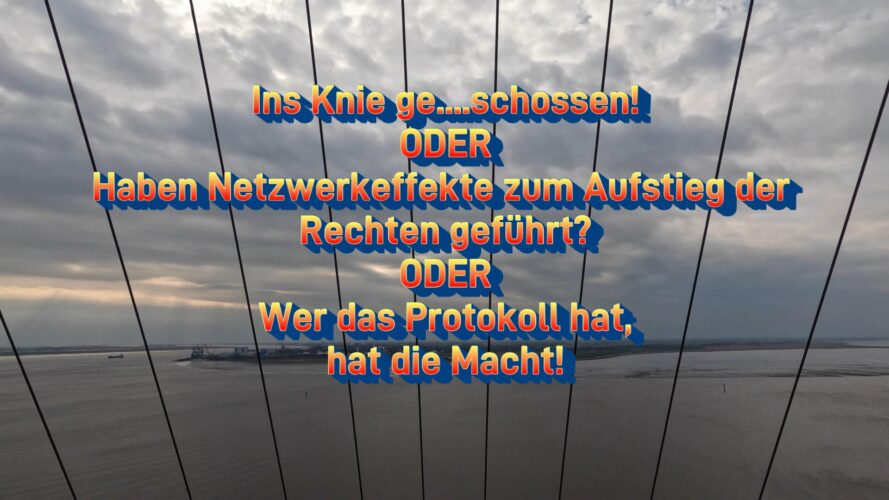Ins Knie ge….schossen!
ODER
Haben Netzwerkeffekte zum Aufstieg der
Rechten geführt?
ODER
Wer das Protokoll hat,
hat die Macht!
Warum wählen Menschen Parteien, von denen sie wissen, daß sie nicht ihre Interessen vertreten werden?
In den USA zeigt die NYT ein Beispiel in New York: Menschen fürchten sich vor Maßnahmen eines Mannes, den sie selbst gewählt haben.
Ein Einwandererviertel, in dem Trump Erfolge erzielte, fürchtet nun ICE-Razzien
In Corona, einer einst pulsierenden New Yorker Enklave, in der mehrere Generationen lateinamerikanischer Einwanderer lebten, trauen sich viele Einwohner angesichts der drohenden Massenabschiebungen nicht mehr, das Haus zu verlassen.
Oder West Verginia, so ein Beitrag von Paul Krugmann auf Substack.
Bemerkenswert ist jedoch, dass wir trotz allem Gerede darüber, die Republikanische Partei sei nun die Partei der Arbeiterklasse, feststellen, dass ihre politische Agenda genauso grausam plutokratisch ist wie eh und je: Man will den Amerikanern, die sie brauchen, die Gesundheitsversorgung entziehen, damit man die Steuern für die Reichen senken kann
In Deutschland ist schon lange bekannt, daß die AFD eher den Besserverdienenden dienen und ihre Migrationspolitik das Gesundheitssystem an die Grenze bringen würde.
Warum?
Der Versuch einer Antwort fängt bei einem Beitrag in der Zeitschrift ” TheNewAtlantic” an:
Der Beitrag von Jon Askonas geht tief in die Konzept von Protokollen ein, die digitalen Vereinbarungen, die es erst ermöglichten, daß das Internet, so wie wir es kennen, überhaupt entstehen konnte. Es geht weiter über Netzwerkeffekte bis zum Verhalten eines Schwarms.
Aber, ein Absatz machte mich stutzig:
Zitat:
Das wichtigste Merkmal des Schwarms ist, was er nicht ist: Er ist kein „Wir“, keine Bewegung oder Gemeinschaft, der man sich anschließt. Seine Mitglieder sind sich möglicherweise nicht einmal bewusst, dass sie kollektiv handeln, und haben möglicherweise ganz unterschiedliche Motivationen und Ziele. Wenn überhaupt, scheint der Schwarm einen fremden Willen zu haben, eine kollektive Richtung, die im völligen Widerspruch zu den Überzeugungen und Wünschen jedes Einzelnen in ihm stehen kann – der Literaturtheoretiker René Girard identifizierte den Schwarm mit dem Satanischen.
Um darzustellen, was die Aussagen in seinem Beitrag im Kern bedeuten, habe ich mit ChatGPT bedient:
Hier also der Dialog:
Haben Netzwerkeffekte zum Aufstieg der rechten Parteien geführt?
Ja, Netzwerkeffekte haben eine wichtige Rolle beim Aufstieg rechter Parteien gespielt. Hier sind einige zentrale Mechanismen, durch die Netzwerkeffekte diesen politischen Wandel begünstigt haben:
- Soziale Medien als Verstärker
- Rechte Parteien und Bewegungen nutzen gezielt soziale Medien, um ihre Botschaften zu verbreiten. Algorithmen auf Plattformen wie Facebook, X (ehemals Twitter) oder YouTube belohnen provokanten und polarisierenden Content, da er hohe Interaktionsraten erzeugt.
- Sobald eine kritische Masse an Nutzern solche Inhalte teilt und kommentiert, verstärkt sich der Effekt durch weitere Reichweite.
- Echokammern und Filterblasen
- Netzwerkeffekte führen dazu, dass Menschen sich verstärkt mit Gleichgesinnten vernetzen. Das schafft Echokammern, in denen sich bestimmte Narrative immer wieder selbst bestätigen.
- Dadurch können sich Meinungen radikalisieren, und Fake News oder Verschwörungstheorien finden leichter Verbreitung.
- Alternative Medien und Mobilisierung
- Rechte Gruppen haben eigene Medienplattformen und Blogs aufgebaut, die durch Netzwerkeffekte wachsen. Diese Plattformen bieten Alternativen zum etablierten Journalismus und verstärken das Misstrauen gegenüber klassischen Medien.
- Bewegungen wie Pegida oder die „Gelbwesten“ in Frankreich haben gezeigt, wie Netzwerkeffekte Online-Organisation und Offline-Mobilisierung erleichtern.
- Memes und virale Kommunikation
- Die rechte Szene nutzt virale Mechanismen effektiv. Memes, provokante Slogans oder einfache Narrative lassen sich schnell teilen und sprechen besonders junge Nutzer an.
- Durch virale Verbreitung wird eine Partei oder Bewegung oft überproportional wahrgenommen, selbst wenn sie gesellschaftlich nur eine Minderheitenposition vertritt.
- Schneeballeffekt bei Wahlerfolgen
- Sobald rechte Parteien Wahlerfolge erzielen, verstärkt sich ihr Wachstum durch einen Selbstverstärkungseffekt: Medien berichten mehr, neue Wähler fühlen sich legitimiert, Unterstützer gewinnen an Selbstbewusstsein.
Fazit
Netzwerkeffekte haben rechte Parteien nicht allein groß gemacht, aber sie haben deren Aufstieg erheblich beschleunigt. Besonders die Dynamik in sozialen Medien, alternative Informationsnetzwerke und digitale Mobilisierung haben dazu beigetragen, dass rechte Ideologien in vielen Ländern an Einfluss gewonnen haben.

Schwarmintelligenz? oder Schwarmdummeit?
( kann sich noch jemand an die PIRATEN erinnern?)
Ja, der Effekt der Schwarmintelligenz kann einen Einfluss auf die politische Meinungsbildung haben – sowohl positiv als auch negativ. Schwarmintelligenz bezeichnet das Phänomen, dass Gruppen durch kollektives Wissen oft bessere Entscheidungen treffen als Einzelpersonen. Allerdings kann dieser Effekt durch Manipulation, Gruppendynamiken oder Fehlinformationen verzerrt werden.
Positive Effekte von Schwarmintelligenz auf die politische Meinungsbildung
- Weisheit der Vielen
- Wenn Menschen unabhängig voneinander Informationen bewerten und diskutieren, kann die kollektive Meinung oft objektiver und präziser sein als individuelle Urteile.
- Beispiel: Crowdsourcing von politischen Lösungen oder offene Diskussionsplattformen können zu besseren politischen Entscheidungen führen.
- Demokratisierung von Informationen
- Durch das Internet haben mehr Menschen Zugang zu politischem Wissen, wodurch sie fundiertere Entscheidungen treffen können.
- Digitale Plattformen erlauben direkte Mitbestimmung (z. B. Petitionen, Bürgerhaushalte).
- Frühwarnsysteme für gesellschaftliche Probleme
- Die kollektive Beobachtung und Diskussion in sozialen Netzwerken kann Missstände schneller aufdecken (z. B. #MeToo oder Fridays for Future).
Negative Effekte von Schwarmintelligenz auf die politische Meinungsbildung
- Echokammern & Gruppenpolarisation
- Wenn Menschen sich nur mit Gleichgesinnten austauschen, verstärken sich ihre Meinungen, anstatt sich auszugleichen.
- Das kann zur Radikalisierung führen, anstatt zu einer ausgewogenen Sichtweise.
- Fehlinformation & Massenhysterie
- Schwärme können sich auch in die falsche Richtung bewegen, wenn Desinformation oder emotionale Impulse dominieren (z. B. Fake News oder Verschwörungstheorien).
- Beispiel: Der Sturm auf das Kapitol 2021 war teilweise das Ergebnis kollektiver Dynamiken in sozialen Netzwerken.
- Manipulation durch gezielte Beeinflussung
- Politische Akteure, Trolle oder Bots können Schwärme manipulieren, indem sie gezielt Meinungen verstärken oder falsche Narrative setzen.
- Beispiel: Wahlbeeinflussung durch Social Bots oder Microtargeting bei politischen Kampagnen.
Fazit
Schwarmintelligenz kann die politische Meinungsbildung sowohl verbessern als auch verzerren. Während sie dazu beitragen kann, Wissen zu sammeln und kollektive Probleme zu lösen, kann sie auch durch psychologische Effekte, soziale Medien und gezielte Manipulation in destruktive Bahnen gelenkt werden. Entscheidend ist, wie die kollektive Informationsverarbeitung gesteuert und geschützt wird.
Was ist die neue Kontrollgesellschaft?
Der Begriff “neue Kontrollgesellschaft” stammt aus der kritischen Sozial- und Medientheorie und beschreibt eine Weiterentwicklung der Überwachungs- und Kontrollmechanismen in modernen Gesellschaften. Er geht auf den französischen Philosophen Gilles Deleuze zurück, der ihn als eine Weiterentwicklung der Disziplinargesellschaft (Michel Foucault) verstand.
Merkmale der neuen Kontrollgesellschaft
- Von geschlossenen Institutionen zur permanenten Kontrolle
- Während Foucaults Disziplinargesellschaft auf Institutionen wie Schulen, Fabriken und Gefängnisse setzte, um Individuen zu formen, funktioniert Kontrolle heute dezentral und kontinuierlich.
- Menschen stehen nicht mehr unter direkter Aufsicht, sondern werden durch digitale Technologien, Algorithmen und soziale Dynamiken gelenkt.
- Digitale Überwachung & Big Data
- Soziale Medien, Smartphones und das Internet ermöglichen eine lückenlose Datenerfassung.
- Regierungen und Unternehmen nutzen Predictive Analytics, um das Verhalten von Individuen vorherzusagen und zu steuern.
- China mit seinem Social Credit System oder der Einsatz von KI-gestützten Überwachungssystemen sind extreme Beispiele.
- Sanfte Steuerung durch Anreize statt harte Verbote
- Kontrolle geschieht oft nicht mehr durch direkte Verbote, sondern durch Nudging (sanfte Verhaltenslenkung).
- Beispiel: Empfehlungsalgorithmen auf YouTube oder TikTok steuern, welche Inhalte sichtbar sind und beeinflussen damit unser Denken.
- Unternehmen und Staaten setzen auf Belohnungssysteme anstelle von direkter Repression.
- Selbstkontrolle durch Social Media & Gruppenzwang
- Menschen überwachen sich zunehmend selbst durch soziale Medien, Likes und digitale Reputation.
- Die Angst vor “Shitstorms” oder öffentlicher Bloßstellung führt dazu, dass sich viele freiwillig anpassen.
- Fließende Identitäten & permanente Optimierung
- In der Kontrollgesellschaft gibt es keine klaren Grenzen mehr zwischen Arbeit und Freizeit, Öffentlichkeit und Privatleben.
- Menschen sind ständig online, erreichbar und produktiv – das erzeugt einen neuen Druck zur Selbstoptimierung.
Fazit
Die neue Kontrollgesellschaft ersetzt klassische Disziplinierung durch eine unsichtbare, allgegenwärtige Steuerung. Algorithmen, soziale Medien und digitale Überwachung führen dazu, dass Menschen sich freiwillig anpassen, ohne dass offene Gewalt oder Zwang nötig ist. Kontrolle wird subtiler, aber auch umfassender und schwerer zu hinterfragen.
Führt die neue Kontrollgesellschaft zum Aufstieg der rechten Parteien?
Ja, die neue Kontrollgesellschaft kann den Aufstieg rechter Parteien beeinflussen – aber nicht zwingend im Sinne einer direkten Förderung. Vielmehr erzeugt sie gesellschaftliche Dynamiken, die rechte Bewegungen begünstigen können. Hier sind einige zentrale Mechanismen:
1. Vertrauensverlust in Institutionen & das Establishment
- Die umfassende digitale Überwachung und Datensammlung durch Staaten und Konzerne führt zu einem Gefühl der Entmündigung.
- Viele Menschen misstrauen Regierungen, Medien und Unternehmen, was Populisten nutzen, um sich als Alternative zum System zu präsentieren.
- Verschwörungstheorien über „Eliten“, „Überwachungsstaat“ oder „Great Reset“ finden in diesem Klima leichter Anhänger.
2. Algorithmen verstärken Polarisierung
- Soziale Medien belohnen polarisierende und emotionale Inhalte – rechte Parteien nutzen das geschickt aus.
- Provokative, wütende Botschaften haben oft mehr Reichweite als sachliche Diskussionen.
- Dadurch wirken rechte Akteure präsenter, selbst wenn sie nur eine Minderheitenposition vertreten.
3. Angst & Unsicherheit als Mobilisierungsfaktor
- Die Kontrollgesellschaft erzeugt ein Gefühl der ständigen Bewertung (z. B. Social-Media-Reputation, Überwachung am Arbeitsplatz).
- In Kombination mit wirtschaftlicher Unsicherheit (z. B. Automatisierung, Jobverlust durch KI) führt das zu einer Kultur der Angst.
- Rechte Parteien profitieren, indem sie einfache Lösungen anbieten („Grenzen dicht!“, „Eliten stürzen!“).
4. Selbstkontrolle & Cancel Culture als Gegenreaktion
- Die Kontrollgesellschaft führt dazu, dass Menschen sich in öffentlichen Diskussionen zurückhalten („Ich darf ja nichts mehr sagen!“).
- Rechte Parteien stellen sich als Verteidiger der „Meinungsfreiheit“ dar – auch wenn sie selbst oft autoritäre Maßnahmen fordern.
5. Fragmentierung & Schwächung klassischer Parteien
- Früher gaben Massenmedien wie Zeitungen oder Fernsehen einen gemeinsamen politischen Rahmen vor.
- Heute bestimmen individuelle Newsfeeds und alternative Medien das Weltbild vieler Menschen.
- Das erschwert es etablierten Parteien, große Wählergruppen zusammenzuhalten – eine Chance für radikale Außenseiter.
Fazit
Die neue Kontrollgesellschaft schafft ein Klima der Verunsicherung, Polarisierung und Misstrauens, das rechte Parteien gezielt ausnutzen. Sie sind nicht direkt ein Produkt dieser Gesellschaft, aber sie profitieren von ihren Nebenwirkungen.
Leben wir in einer neuen Kontrollgesellschaft?
Ja, viele Merkmale der neuen Kontrollgesellschaft sind heute Realität. Allerdings ist sie nicht totalitär oder allumfassend – sie wirkt subtiler und durch sanfte Steuerung statt offene Repression.
Anzeichen dafür, dass wir in einer neuen Kontrollgesellschaft leben
- Digitale Überwachung & Datensammlung
- Smartphones, soziale Medien und Überwachungskameras erfassen permanent Daten über unser Verhalten.
- Staaten und Konzerne nutzen diese Daten für Sicherheitszwecke, aber auch zur Verhaltenssteuerung (z. B. personalisierte Werbung, Social Scoring in China).
- Sanfte Kontrolle durch Algorithmen
- Algorithmen bestimmen, welche Informationen wir sehen, mit wem wir interagieren und welche Produkte oder Meinungen uns empfohlen werden.
- Das führt zu subtiler Lenkung, ohne dass wir es bewusst merken.
- Selbstkontrolle & sozialer Druck
- Durch soziale Medien sind wir ständig der Bewertung anderer ausgesetzt (Likes, Kommentare, Shitstorms).
- Das führt dazu, dass viele sich selbstzensieren oder bestimmte Themen meiden.
- Arbeit & Freizeit verschwimmen
- Ständige Erreichbarkeit durch Homeoffice, digitale Tools und KI-gestützte Leistungsüberwachung setzen Arbeitnehmer unter Druck.
- Die Vorstellung, sich immer weiter selbst optimieren zu müssen (z. B. Fitness-Apps, Productivity-Hacks), ist Teil der neuen Kontrolle.
- Nudging statt direkte Verbote
- Der Staat und Unternehmen setzen zunehmend auf sanfte Lenkung statt auf harte Gesetze.
- Beispiel: CO₂-Steuern, Gamification von Verhaltensänderungen (z. B. Gesundheits-Apps, Smart Cities).
Aber: Es gibt auch Widerstände
- Datenschutzbewegungen (z. B. DSGVO, Anti-Überwachungsproteste) zeigen, dass Kontrolle hinterfragt wird.
- Dezentrale Technologien wie Kryptowährungen oder das Darknet bieten Alternativen.
- Kritisches Bewusstsein wächst – viele Menschen erkennen die Mechanismen der neuen Kontrolle und entwickeln Gegenstrategien.
Fazit
Ja, wir leben in einer neuen Kontrollgesellschaft – aber sie ist nicht totalitär, sondern funktioniert über Anreize, Daten und sozialen Druck. Kontrolle ist subtiler und allgegenwärtiger, aber auch flexibler und nicht unumkehrbar.